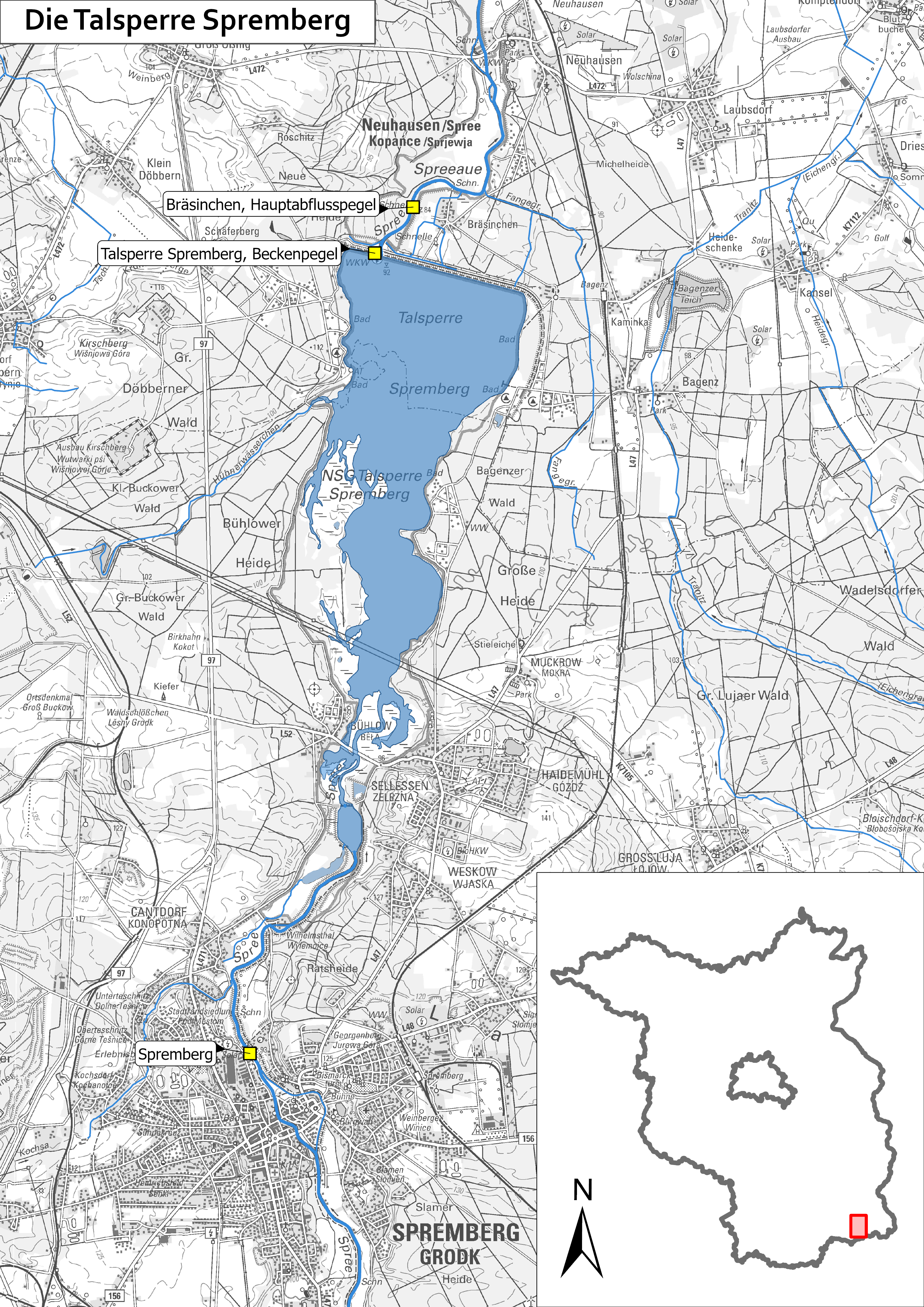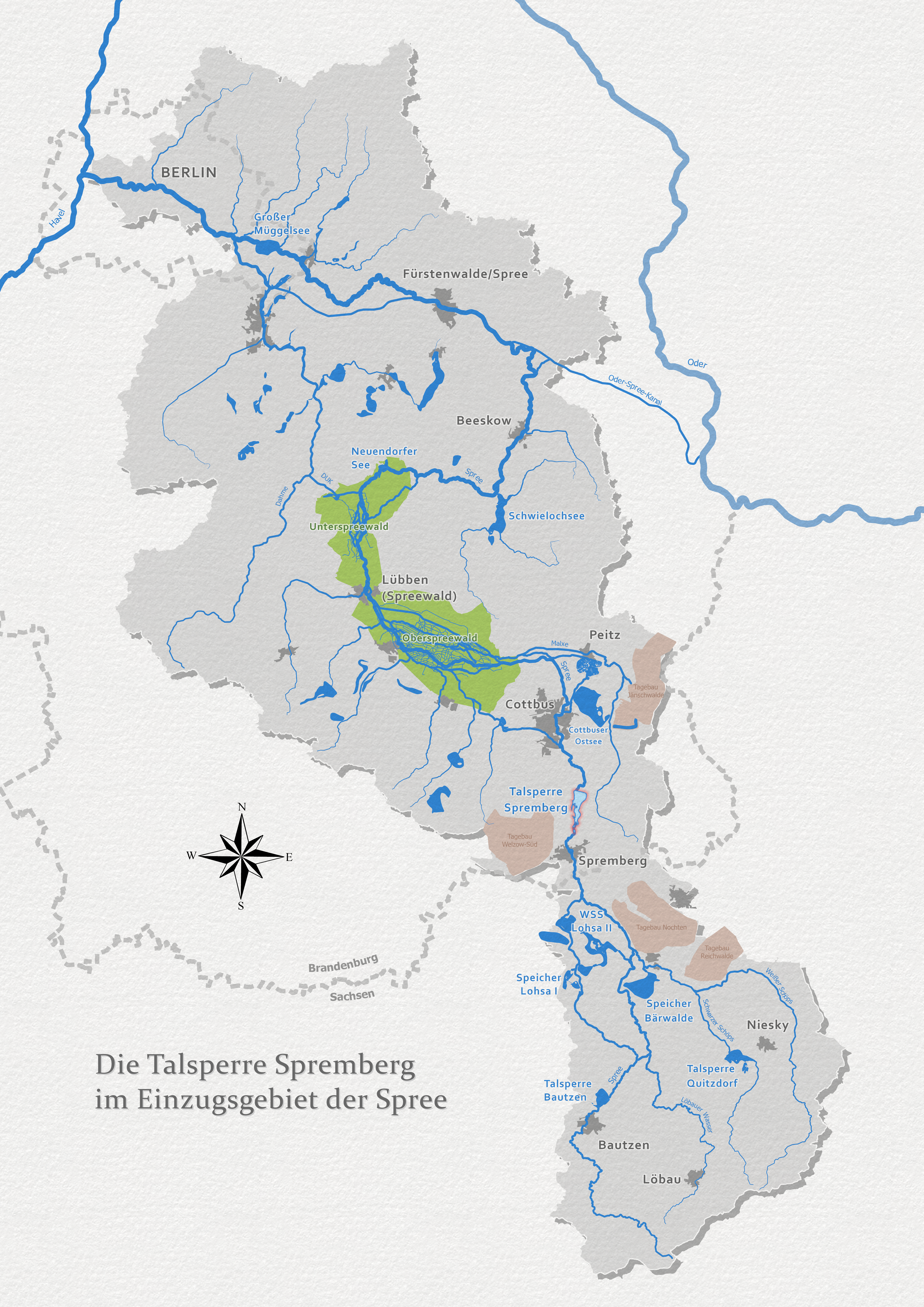Talsperre Spremberg


Die Talsperre Spremberg ist das größte wasserwirtschaftliche Bauwerk im Land Brandenburg. Außerdem ist sie im Weltregister der großen Talsperren aufgeführt, dem „World Register of Dams“ der Internationalen Commission on Large Dams (ICOLD) aufgeführt.
Brandenburg zählt nicht zu den klassischen Regionen des Talsperrenbaus. Geografische Lage sowie geologische und topografische Verhältnisse sprechen dagegen. Dennoch wurde im Süden des heutigen Bundeslandes Brandenburg in den 1950er Jahren ein äußerst anspruchsvolles Projekt in Angriff genommen und die Talsperre Spremberg zwischen Bräsinchen im Norden und Spremberg im Süden errichtet.
Sie ist Teil eines ganzen Speichersystems im oberen Einzugsgebiet der Spree, zu dem auch die Speicherbecken Lohsa und die Talsperren Quitzdorf und Bautzen im heutigen Sachsen zählen. Ziel war es, natürliche Ressourcen besser zu nutzen, die Anrainer der Spree vor Hochwasser zu schützen und – vor allem – die Brauchwasserversorgung der Lausitzer Braunkohlenkraftwerke und damit die Energieversorgung der DDR zu sichern.
Der Bau erstreckte sich über die Jahre 1958 bis 1965. Nach einer rund dreijährigen Probephase ab 1962, in der auch Ergänzungen am Sickerwassersystem und den Dichtungsanschlüssen erfolgten, wurde die Talsperre am 8.Oktober 1965 offiziell in Betrieb genommen.
Mit dem Bau dieser Talsperre wurde eine konstruktive Pionierleistung erbracht. Denn die Lage in einem weiten, flachen Tal mit stark durchströmten Untergrund stellte außergewöhnliche Anforderungen an die Errichtung des Staudammes.
Mit dem schrittweisen Ausstieg aus dem Braunkohlenbergbau verändern sich seit 1990 die wasserwirtschaftlichen Schwerpunkte für die Bewirtschaftung der Talsperre. Neben dem Hochwasserschutz steht jetzt vor allem die zusätzliche Wasserbereitstellung in Trockenzeiten - im Verbund mit den sächsischen Talsperren - im Fokus.
Der Braunkohlenbergbau hat das Lausitzer Einzugsgebiet der Spree hydrologisch stark verändert. Durch den Klimawandel mit höheren Temperaturen und geringeren Abflüssen wird das Niedrigwasserproblem weiter verschärft. Gleichzeit wächst die Hochwassergefahr durch Extremwetterlagen mit Starkniederschlägen und anhaltenden Regenereignissen.
Die Talsperre Spremberg muss sowohl den Normalbetrieb aber auch Extremsituationen bewältigen können. Deshalb findet hier bei laufenden Betrieb eine umfassende Generalsanierung des Bauwerks statt. Seit dem Jahr 2005 setzt das Land Brandenburg, unterstützt von der Europäischen Union und dem Bund umfangreiche finanzielle Mittel dafür ein.
Auf dem Weg in die Talsperre Spremberg passiert das Spreewasser zunächst die Vorsperre bei Bühlow, die ursprünglich dem Rückhalt von Sedimenten aus Hochwässern diente. Seit 2017 wird hier Eisenockerschlamm entnommen, der aus ehemaligen Braunkohlengebieten südlich Spremberg in die Spree fließt und das Ökosystem der Spree und des Spreewaldes gefährdet. Mit der jährlichen Beräumung der Vorsperre Bühlow wird neben anderen Maßnahmen der LMBV ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet, dass das Spreewasser die Talsperre in klarem Zustand verlässt. Die Qualität der Talsperre als Gewässerlebensraum wird durch ein jährliches Fischmonitoring mit guten Ergebnissen überprüft.
Die große Wasserfläche der Talsperre und die vielfältigen Strukturen im Umfeld führten dazu, dass sich hier eine besonders reichhaltige Naturausstattung mit einer besonderen Anziehungskraft für Erholungssuchende und Naturfreunde entwickelt hat.
Die Talsperre Spremberg ist das größte wasserwirtschaftliche Bauwerk im Land Brandenburg. Außerdem ist sie im Weltregister der großen Talsperren aufgeführt, dem „World Register of Dams“ der Internationalen Commission on Large Dams (ICOLD) aufgeführt.
Brandenburg zählt nicht zu den klassischen Regionen des Talsperrenbaus. Geografische Lage sowie geologische und topografische Verhältnisse sprechen dagegen. Dennoch wurde im Süden des heutigen Bundeslandes Brandenburg in den 1950er Jahren ein äußerst anspruchsvolles Projekt in Angriff genommen und die Talsperre Spremberg zwischen Bräsinchen im Norden und Spremberg im Süden errichtet.
Sie ist Teil eines ganzen Speichersystems im oberen Einzugsgebiet der Spree, zu dem auch die Speicherbecken Lohsa und die Talsperren Quitzdorf und Bautzen im heutigen Sachsen zählen. Ziel war es, natürliche Ressourcen besser zu nutzen, die Anrainer der Spree vor Hochwasser zu schützen und – vor allem – die Brauchwasserversorgung der Lausitzer Braunkohlenkraftwerke und damit die Energieversorgung der DDR zu sichern.
Der Bau erstreckte sich über die Jahre 1958 bis 1965. Nach einer rund dreijährigen Probephase ab 1962, in der auch Ergänzungen am Sickerwassersystem und den Dichtungsanschlüssen erfolgten, wurde die Talsperre am 8.Oktober 1965 offiziell in Betrieb genommen.
Mit dem Bau dieser Talsperre wurde eine konstruktive Pionierleistung erbracht. Denn die Lage in einem weiten, flachen Tal mit stark durchströmten Untergrund stellte außergewöhnliche Anforderungen an die Errichtung des Staudammes.
Mit dem schrittweisen Ausstieg aus dem Braunkohlenbergbau verändern sich seit 1990 die wasserwirtschaftlichen Schwerpunkte für die Bewirtschaftung der Talsperre. Neben dem Hochwasserschutz steht jetzt vor allem die zusätzliche Wasserbereitstellung in Trockenzeiten - im Verbund mit den sächsischen Talsperren - im Fokus.
Der Braunkohlenbergbau hat das Lausitzer Einzugsgebiet der Spree hydrologisch stark verändert. Durch den Klimawandel mit höheren Temperaturen und geringeren Abflüssen wird das Niedrigwasserproblem weiter verschärft. Gleichzeit wächst die Hochwassergefahr durch Extremwetterlagen mit Starkniederschlägen und anhaltenden Regenereignissen.
Die Talsperre Spremberg muss sowohl den Normalbetrieb aber auch Extremsituationen bewältigen können. Deshalb findet hier bei laufenden Betrieb eine umfassende Generalsanierung des Bauwerks statt. Seit dem Jahr 2005 setzt das Land Brandenburg, unterstützt von der Europäischen Union und dem Bund umfangreiche finanzielle Mittel dafür ein.
Auf dem Weg in die Talsperre Spremberg passiert das Spreewasser zunächst die Vorsperre bei Bühlow, die ursprünglich dem Rückhalt von Sedimenten aus Hochwässern diente. Seit 2017 wird hier Eisenockerschlamm entnommen, der aus ehemaligen Braunkohlengebieten südlich Spremberg in die Spree fließt und das Ökosystem der Spree und des Spreewaldes gefährdet. Mit der jährlichen Beräumung der Vorsperre Bühlow wird neben anderen Maßnahmen der LMBV ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet, dass das Spreewasser die Talsperre in klarem Zustand verlässt. Die Qualität der Talsperre als Gewässerlebensraum wird durch ein jährliches Fischmonitoring mit guten Ergebnissen überprüft.
Die große Wasserfläche der Talsperre und die vielfältigen Strukturen im Umfeld führten dazu, dass sich hier eine besonders reichhaltige Naturausstattung mit einer besonderen Anziehungskraft für Erholungssuchende und Naturfreunde entwickelt hat.
Technische Daten
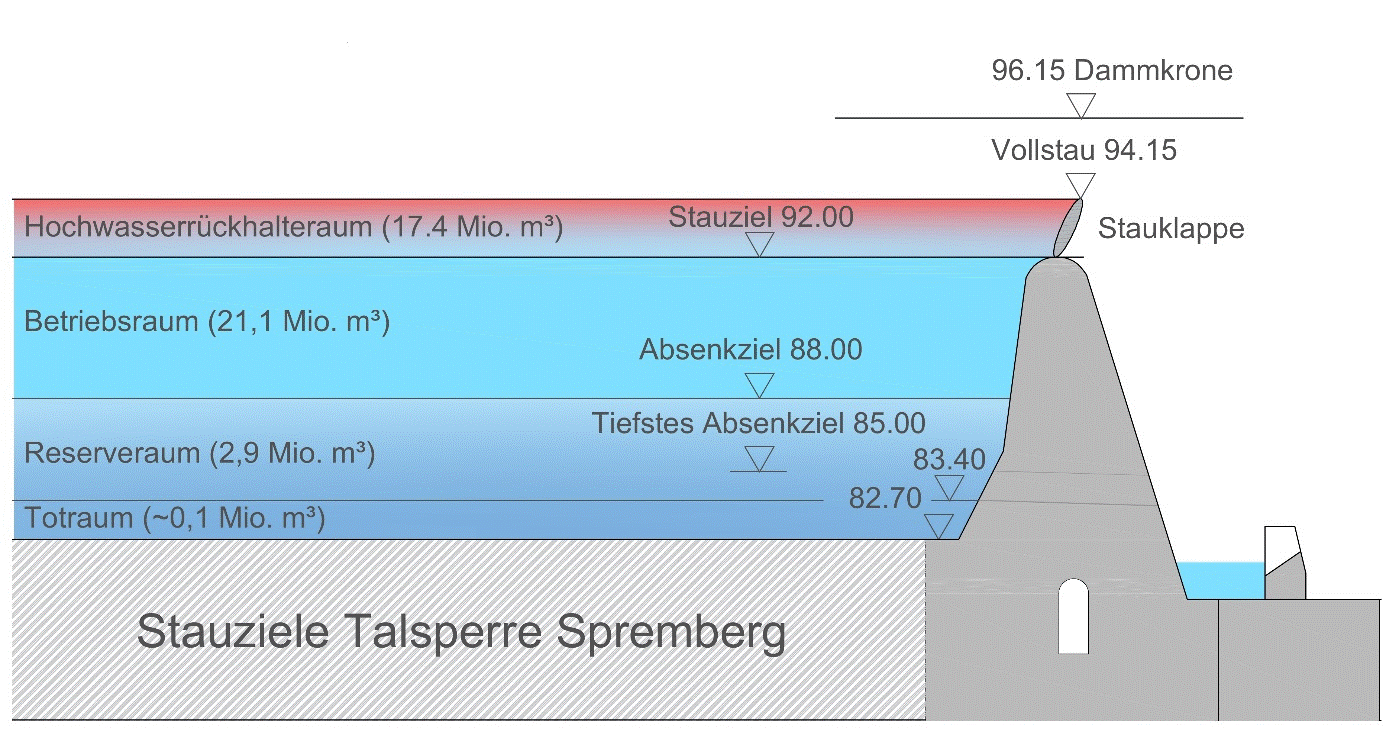
| Hydrologie | |
| Einzugsgebiet | 2.281 km2 |
| Jahresabflusssumme | 390 Mio m3 |
| Staudamm - das Absperrbauwerk | |
| Länge der Dammkrone | 3700 m |
| Höhe der Dammkrone | 12 m |
| Breite der Dammkrone | 5 m |
| Böschungsneigung wasserseitig | 1:3,5 - Berme 1:4,5 |
| Böschungsneigung landseitig | 1:2 - Berme 1:2,5 |
| Staubecken | |
| Höchster möglicher Stau | 94,15 m.ü.NN |
| Stauziel (Dauerstau) | 92,00 m.ü.NN |
| Gesamtstauraum | 38,47 Mio m³ |
| Hochwasser-Rückhalteraum | 17,40 Mio m³ |
| Betriebsraum | 21,06 Mio m³ |
| Speicherfläche (maximal) | 8,99 km² |
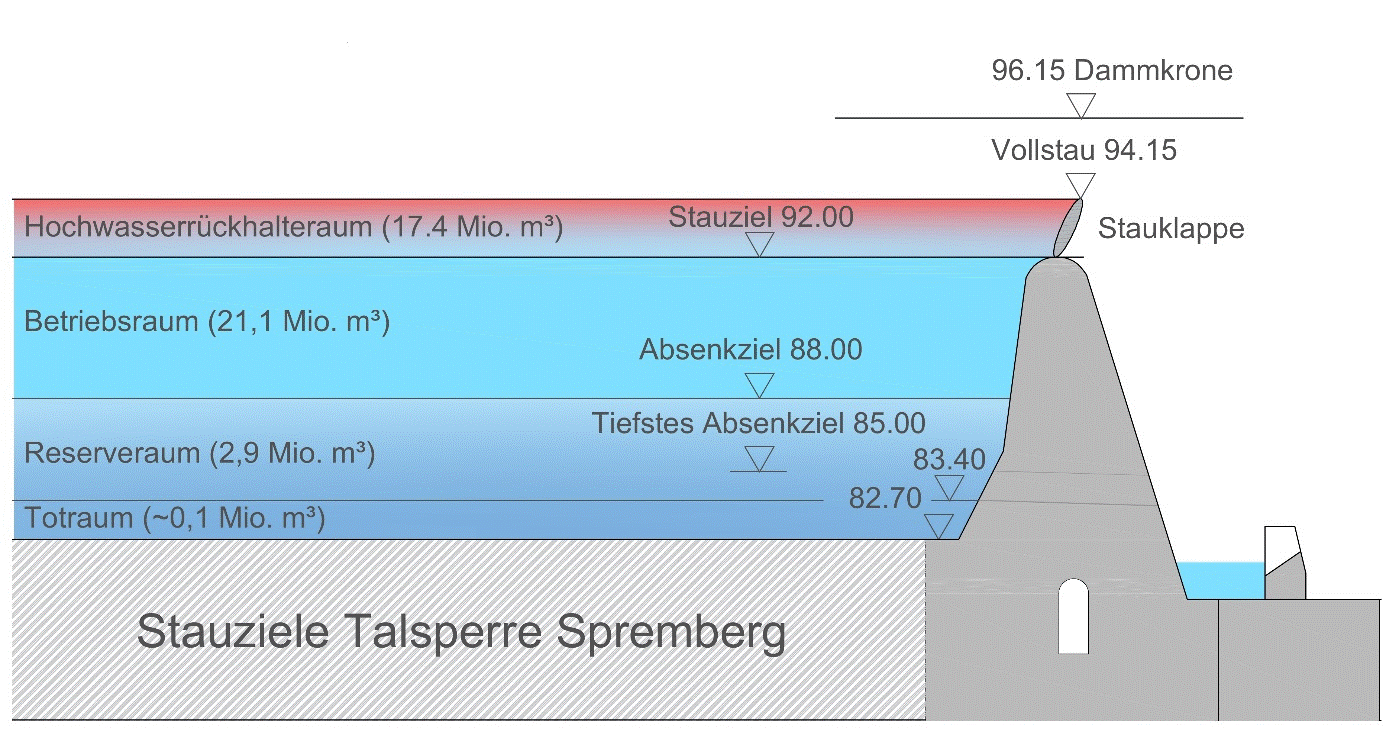
| Hydrologie | |
| Einzugsgebiet | 2.281 km2 |
| Jahresabflusssumme | 390 Mio m3 |
| Staudamm - das Absperrbauwerk | |
| Länge der Dammkrone | 3700 m |
| Höhe der Dammkrone | 12 m |
| Breite der Dammkrone | 5 m |
| Böschungsneigung wasserseitig | 1:3,5 - Berme 1:4,5 |
| Böschungsneigung landseitig | 1:2 - Berme 1:2,5 |
| Staubecken | |
| Höchster möglicher Stau | 94,15 m.ü.NN |
| Stauziel (Dauerstau) | 92,00 m.ü.NN |
| Gesamtstauraum | 38,47 Mio m³ |
| Hochwasser-Rückhalteraum | 17,40 Mio m³ |
| Betriebsraum | 21,06 Mio m³ |
| Speicherfläche (maximal) | 8,99 km² |
Der Staudamm – ein Meisterwerk des Wasserbaus
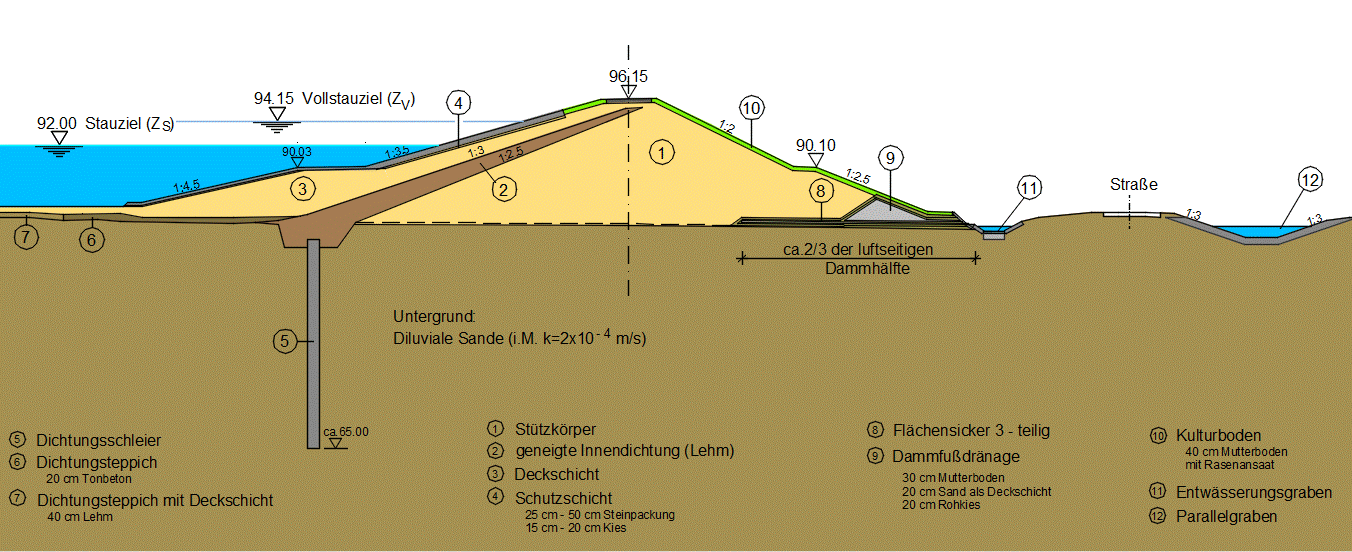
Zwischen Spremberg und Cottbus durchfließt die Spree eine in der Eiszeit entstandene Erosionsrinne und bildet eine Verbindung zwischen dem Lausitzer und dem Baruther Urstromtal. Der Beckenuntergrund besteht aus diluvialen Sanden, die an der Sperrstelle teilweise eine Mächtigkeit von 40 bis 50 Meter haben, darunter befindet sich Braunkohle. Die Sande sind überwiegend fein- bis mittelkörnig, durchsetzt von schwachen fein- bis grobkörnigen Kiesschichten. In feinen Bändern sind Mergel und Ton linsenförmig in unterschiedlicher Stärke und Schluff eingelagert. Der Untergrund des Staubeckens und der Sperrstelle ist sehr durchlässig und stark Grundwasser führend.
So kam an der Sperrstelle als Absperrbauwerk nur ein Erdstaudamm mit hängender, das heißt unterströmter Dichtung in Frage.
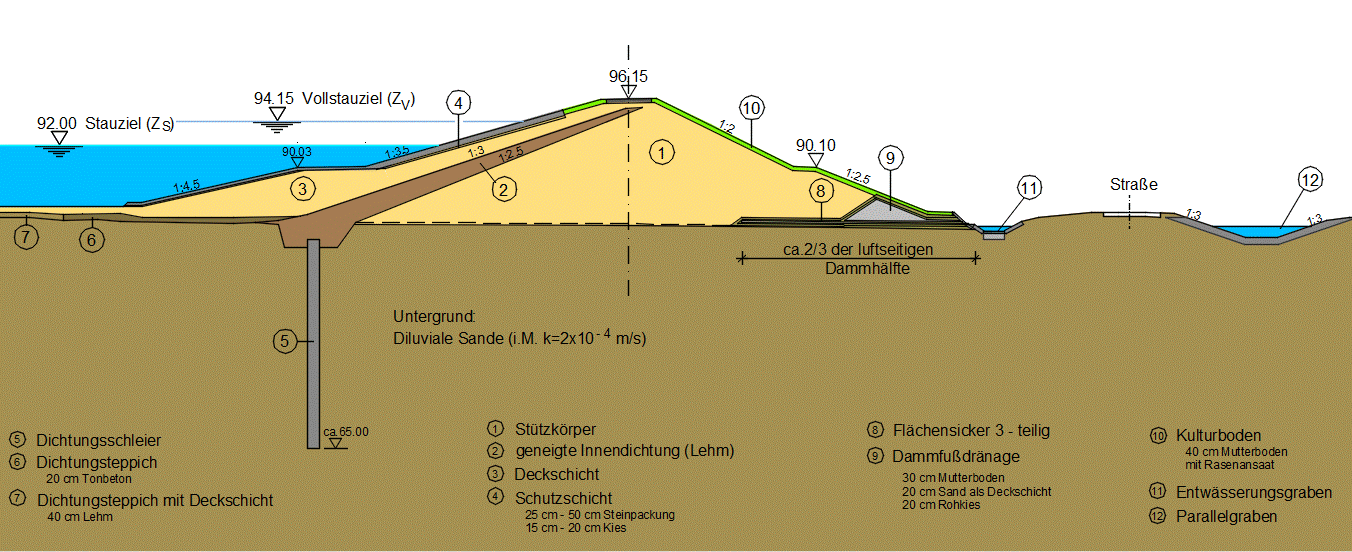
Zwischen Spremberg und Cottbus durchfließt die Spree eine in der Eiszeit entstandene Erosionsrinne und bildet eine Verbindung zwischen dem Lausitzer und dem Baruther Urstromtal. Der Beckenuntergrund besteht aus diluvialen Sanden, die an der Sperrstelle teilweise eine Mächtigkeit von 40 bis 50 Meter haben, darunter befindet sich Braunkohle. Die Sande sind überwiegend fein- bis mittelkörnig, durchsetzt von schwachen fein- bis grobkörnigen Kiesschichten. In feinen Bändern sind Mergel und Ton linsenförmig in unterschiedlicher Stärke und Schluff eingelagert. Der Untergrund des Staubeckens und der Sperrstelle ist sehr durchlässig und stark Grundwasser führend.
So kam an der Sperrstelle als Absperrbauwerk nur ein Erdstaudamm mit hängender, das heißt unterströmter Dichtung in Frage.
Mit den zur Bauzeit möglichen wirtschaftlichen und technischen Mitteln konnte mit einer Untergrundabdichtung die Einbindung in die tiefliegende wassertragende Schicht jedoch nicht erreicht werden.
Mit den zur Bauzeit möglichen wirtschaftlichen und technischen Mitteln konnte mit einer Untergrundabdichtung die Einbindung in die tiefliegende wassertragende Schicht jedoch nicht erreicht werden.
Ausgeführt wurde die Untergrundabdichtung schließlich nach umfangreichen Großversuchen nach dem weiterentwickelten Joosten-Verfahren mit Doppelrohrlanzen. Dabei werden zwei Chemikalien unter hohem Druck gleichzeitig über Doppelrohre in den Untergrund injiziert. Zusammen mit dem anstehenden Lockergestein bilden sie einen dichtenden Schleier. Der zweireihige Dichtungsschleier reicht bis 20 Meter in den Untergrund und riegelt quer zum Tal unter dem Absperrbauwerk eine Fläche von 49.000 m² ab.
Das Baumaterial für den Damm wurde in unmittelbarer Nähe der Baustelle gewonnen. Für Stützkörper und Deckschicht wurde nicht bindiges Lockergestein – diluviale Sande – eingesetzt. Der Einbau erfolgte im Gleisbetrieb in Schütthöhen von 50 Zentimeter, die Verdichtung des sehr gleichförmigen Materials mit Anhängevibrationswalzen mit 25 Mp Verdichtungsdruck. Die geneigte Innendichtung, eine Dichtungsschürze mit Deck- und Erosionsschutzschicht, entstand aus schwachtonigem bis stark sandigem Lehm.
Dem wegen des Untergrunds erhöhten Sicherheitsbedürfnis folgend, wurde unter der Deckschicht ein 20 Zentimeter dicker Tonbetonteppich und vor dem Dammfuß ein 40 Zentimeter dicker Lehmteppich als weiteres horizontales Dichtungselement von insgesamt 20 - 44 Meter Länge je nach Stauhöhe angeordnet.
Zur Abführung des durch Dammkörper und Untergrund sickernden Wassers liegt auf zwei Dritteln des luftseitigen Teiles der Dammkontaktzone ein Flächensicker. Die Dammkrone erhielt nach anfänglicher sandgeschlämmter Schotterdecke später eine Asphaltfahrbahn.
Viele der für diesen Erdstaudamm auf nicht bindigem Lockergestein mit unterströmter Dichtung entwickelten technischen und konstruktiven Lösungen waren wegweisend und gaben Impulse für die Forschung und Entwicklung des Talsperrenbaus.
Ausgeführt wurde die Untergrundabdichtung schließlich nach umfangreichen Großversuchen nach dem weiterentwickelten Joosten-Verfahren mit Doppelrohrlanzen. Dabei werden zwei Chemikalien unter hohem Druck gleichzeitig über Doppelrohre in den Untergrund injiziert. Zusammen mit dem anstehenden Lockergestein bilden sie einen dichtenden Schleier. Der zweireihige Dichtungsschleier reicht bis 20 Meter in den Untergrund und riegelt quer zum Tal unter dem Absperrbauwerk eine Fläche von 49.000 m² ab.
Das Baumaterial für den Damm wurde in unmittelbarer Nähe der Baustelle gewonnen. Für Stützkörper und Deckschicht wurde nicht bindiges Lockergestein – diluviale Sande – eingesetzt. Der Einbau erfolgte im Gleisbetrieb in Schütthöhen von 50 Zentimeter, die Verdichtung des sehr gleichförmigen Materials mit Anhängevibrationswalzen mit 25 Mp Verdichtungsdruck. Die geneigte Innendichtung, eine Dichtungsschürze mit Deck- und Erosionsschutzschicht, entstand aus schwachtonigem bis stark sandigem Lehm.
Dem wegen des Untergrunds erhöhten Sicherheitsbedürfnis folgend, wurde unter der Deckschicht ein 20 Zentimeter dicker Tonbetonteppich und vor dem Dammfuß ein 40 Zentimeter dicker Lehmteppich als weiteres horizontales Dichtungselement von insgesamt 20 - 44 Meter Länge je nach Stauhöhe angeordnet.
Zur Abführung des durch Dammkörper und Untergrund sickernden Wassers liegt auf zwei Dritteln des luftseitigen Teiles der Dammkontaktzone ein Flächensicker. Die Dammkrone erhielt nach anfänglicher sandgeschlämmter Schotterdecke später eine Asphaltfahrbahn.
Viele der für diesen Erdstaudamm auf nicht bindigem Lockergestein mit unterströmter Dichtung entwickelten technischen und konstruktiven Lösungen waren wegweisend und gaben Impulse für die Forschung und Entwicklung des Talsperrenbaus.
Das Grundablass- und Entlastungsbauwerk


Das Grundablass- und Hochwasserentlastungsbauwerk ist in Spreeachse im Damm bei km 0+429 angeordnet. Es bindet mit zwei Mittelblöcken und beidseitig angelegten Hochwasserentlastungen über Flügel und Kernmauern in den Damm ein. Ein gemeinsames Tosbecken schließt sich luftseitig an.
Das Grundablass- und Hochwasserentlastungsbauwerk ist in Spreeachse im Damm bei km 0+429 angeordnet. Es bindet mit zwei Mittelblöcken und beidseitig angelegten Hochwasserentlastungen über Flügel und Kernmauern in den Damm ein. Ein gemeinsames Tosbecken schließt sich luftseitig an.
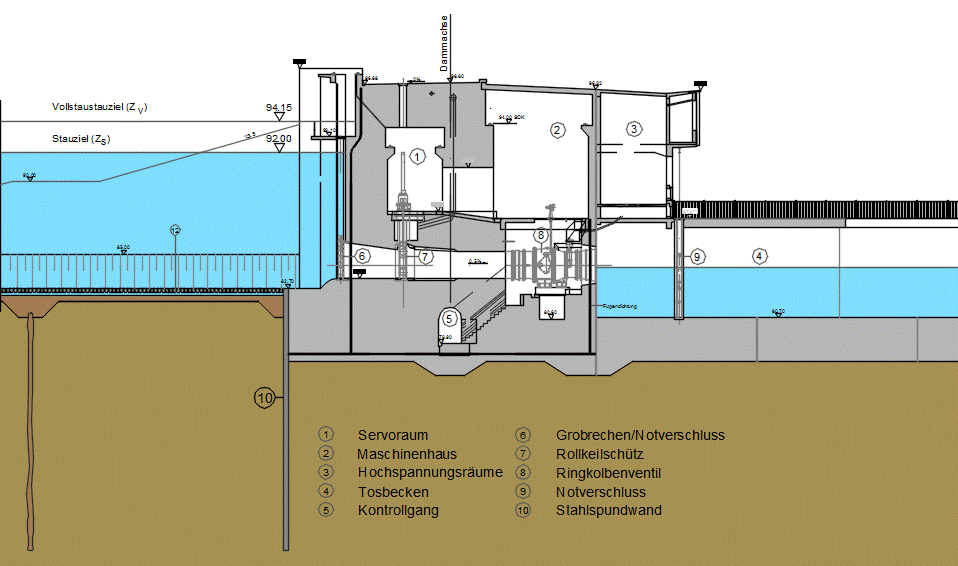
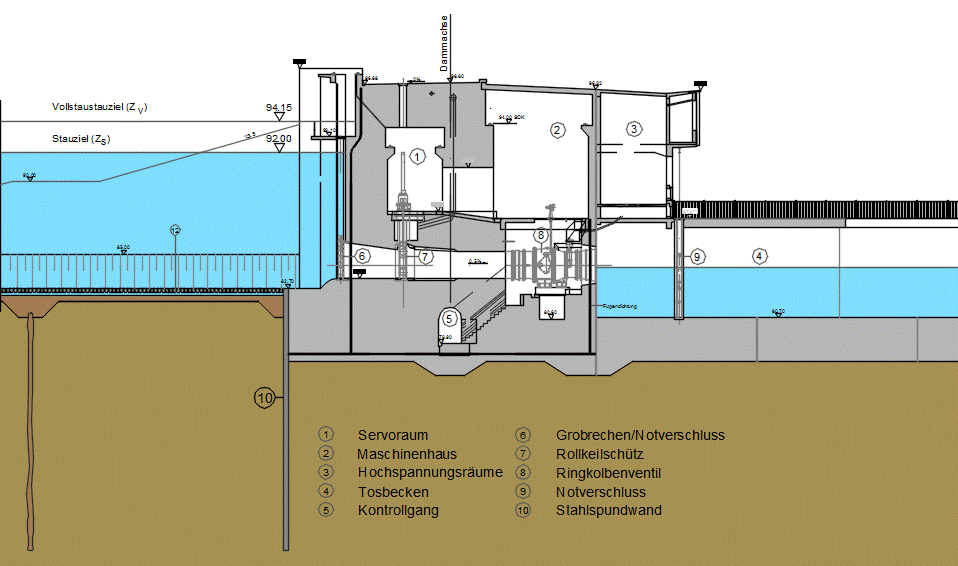
Das Grundablassbauwerk beherbergt die fünf Grundablässe mit einem Durchmesser von je 1,80 Meter, die die gesteuerte Wasserabgabe aus der Talsperre ermöglichen. Ausgestattet sind diese mit Notverschluss / Grobrechen, Rollkeilschütz (Verschlussorgan), Ringkolbenventil DN 1800 (Regelorgan) und luftseitigem Notverschluss.
Das Grundablass- und Entlastungsbauwerk beherbergt auch die Wasserkraftanlage, eine Kaplanturbine mit aufgesetztem Drehstrom-Asynchron-Generator. Diese speist Strom in das Netz eines Energieunternehmens ein. Mit einer Leistung von 1 Megawatt ist es die größte Wasserkraftanlage im Land Brandenburg.
Wenn im Hochwasserfall die Durchflussleistung der Grundablässe erschöpft ist, wird das Wasser zusätzlich über die zwei Hochwasserüberfallrücken mit aufgesetzten Fischbauchklappen abgeleitet. Diese haben je eine Durchflussbreite von 15,50 Meter und die aufgesetzten Fischbauchklappen eine Stauhöhe von 2,15 Meter. In umgelegter Stellung der Klappen kann bei höchstem Stau eine Wassermenge von 100 m³/s je Klappe abgeführt werden.
Das Grundablassbauwerk beherbergt die fünf Grundablässe mit einem Durchmesser von je 1,80 Meter, die die gesteuerte Wasserabgabe aus der Talsperre ermöglichen. Ausgestattet sind diese mit Notverschluss / Grobrechen, Rollkeilschütz (Verschlussorgan), Ringkolbenventil DN 1800 (Regelorgan) und luftseitigem Notverschluss.
Das Grundablass- und Entlastungsbauwerk beherbergt auch die Wasserkraftanlage, eine Kaplanturbine mit aufgesetztem Drehstrom-Asynchron-Generator. Diese speist Strom in das Netz eines Energieunternehmens ein. Mit einer Leistung von 1 Megawatt ist es die größte Wasserkraftanlage im Land Brandenburg.
Wenn im Hochwasserfall die Durchflussleistung der Grundablässe erschöpft ist, wird das Wasser zusätzlich über die zwei Hochwasserüberfallrücken mit aufgesetzten Fischbauchklappen abgeleitet. Diese haben je eine Durchflussbreite von 15,50 Meter und die aufgesetzten Fischbauchklappen eine Stauhöhe von 2,15 Meter. In umgelegter Stellung der Klappen kann bei höchstem Stau eine Wassermenge von 100 m³/s je Klappe abgeführt werden.
Wasserbewirtschaftung
Die Talsperre Spremberg nimmt bei der Wasserbewirtschaftung der Spree eine außerordentlich wichtige Rolle für das Land Brandenburg ein. Sie wirkt im Verbund mit zahlreichen Stauanlagen und den sächsischen Speichern wie ein Ventil zwischen dem Oberlauf in Sachsen und dem brandenburgischen Teil des Einzugsgebietes.
Abflussschwankungen im Zufluss werden durch die Talsperre Spremberg ausgeglichen und gedämpft an den Unterlauf abgegeben. Die genau regulierbare Abgabe erlaubt es, das unterhalb gelegene Gebiet ab Cottbus sehr präzise zu bewirtschaften und Zielwasserstände an den zahlreichen Stauanlagen im Spreewald zu halten. Gemeinsam mit den weiteren Speichern im Oberlauf werden durch die Talsperre Spremberg Niedrigwasserabflüsse aufgehöht, um auch im Sommer eine ausreichende Wasserführung zu gewährleisten.
Da das Wasserdargebot der Spree eher knapp ist, wird die Speicherbewirtschaftung länderübergreifend abgestimmt und koordiniert. Nur so ist es möglich die knappe Ressource optimal zu nutzen.
Auch bei Hochwasser leistet die Talsperre Spremberg einen wichtigen Beitrag zum Schutz des unterhalb gelegenen Gebietes, da Hochwasserspitzen durch die Talsperre gekappt werden können. Durch wöchentliche Funktionskontrollen der Grundablässe und Fischbauchklappen wird sichergestellt, dass die Anlagen im Hochwasserfall gut funktionieren.
Die Talsperre Spremberg nimmt bei der Wasserbewirtschaftung der Spree eine außerordentlich wichtige Rolle für das Land Brandenburg ein. Sie wirkt im Verbund mit zahlreichen Stauanlagen und den sächsischen Speichern wie ein Ventil zwischen dem Oberlauf in Sachsen und dem brandenburgischen Teil des Einzugsgebietes.
Abflussschwankungen im Zufluss werden durch die Talsperre Spremberg ausgeglichen und gedämpft an den Unterlauf abgegeben. Die genau regulierbare Abgabe erlaubt es, das unterhalb gelegene Gebiet ab Cottbus sehr präzise zu bewirtschaften und Zielwasserstände an den zahlreichen Stauanlagen im Spreewald zu halten. Gemeinsam mit den weiteren Speichern im Oberlauf werden durch die Talsperre Spremberg Niedrigwasserabflüsse aufgehöht, um auch im Sommer eine ausreichende Wasserführung zu gewährleisten.
Da das Wasserdargebot der Spree eher knapp ist, wird die Speicherbewirtschaftung länderübergreifend abgestimmt und koordiniert. Nur so ist es möglich die knappe Ressource optimal zu nutzen.
Auch bei Hochwasser leistet die Talsperre Spremberg einen wichtigen Beitrag zum Schutz des unterhalb gelegenen Gebietes, da Hochwasserspitzen durch die Talsperre gekappt werden können. Durch wöchentliche Funktionskontrollen der Grundablässe und Fischbauchklappen wird sichergestellt, dass die Anlagen im Hochwasserfall gut funktionieren.

Nach über 100 Jahren Grundwasserableitung aus Lausitzer Braunkohletagebauen im Spreegebiet steht nun der Kohleausstieg mit dem Ende der Grubenwassereinleitung an. Das ist eine enorme Herausforderung für die Wasserwirtschaft bis sich annähernd naturnahe Grundwasserverhältnisse im Lausitzer Spreegebiet wiedereingestellt haben. Die Talsperre Spremberg ist dabei ein wichtiger Player, um einen Mindestdurchfluss in der Spree im Verbund mit den sächsischen Talsperren sicherzustellen.

Nach über 100 Jahren Grundwasserableitung aus Lausitzer Braunkohletagebauen im Spreegebiet steht nun der Kohleausstieg mit dem Ende der Grubenwassereinleitung an. Das ist eine enorme Herausforderung für die Wasserwirtschaft bis sich annähernd naturnahe Grundwasserverhältnisse im Lausitzer Spreegebiet wiedereingestellt haben. Die Talsperre Spremberg ist dabei ein wichtiger Player, um einen Mindestdurchfluss in der Spree im Verbund mit den sächsischen Talsperren sicherzustellen.
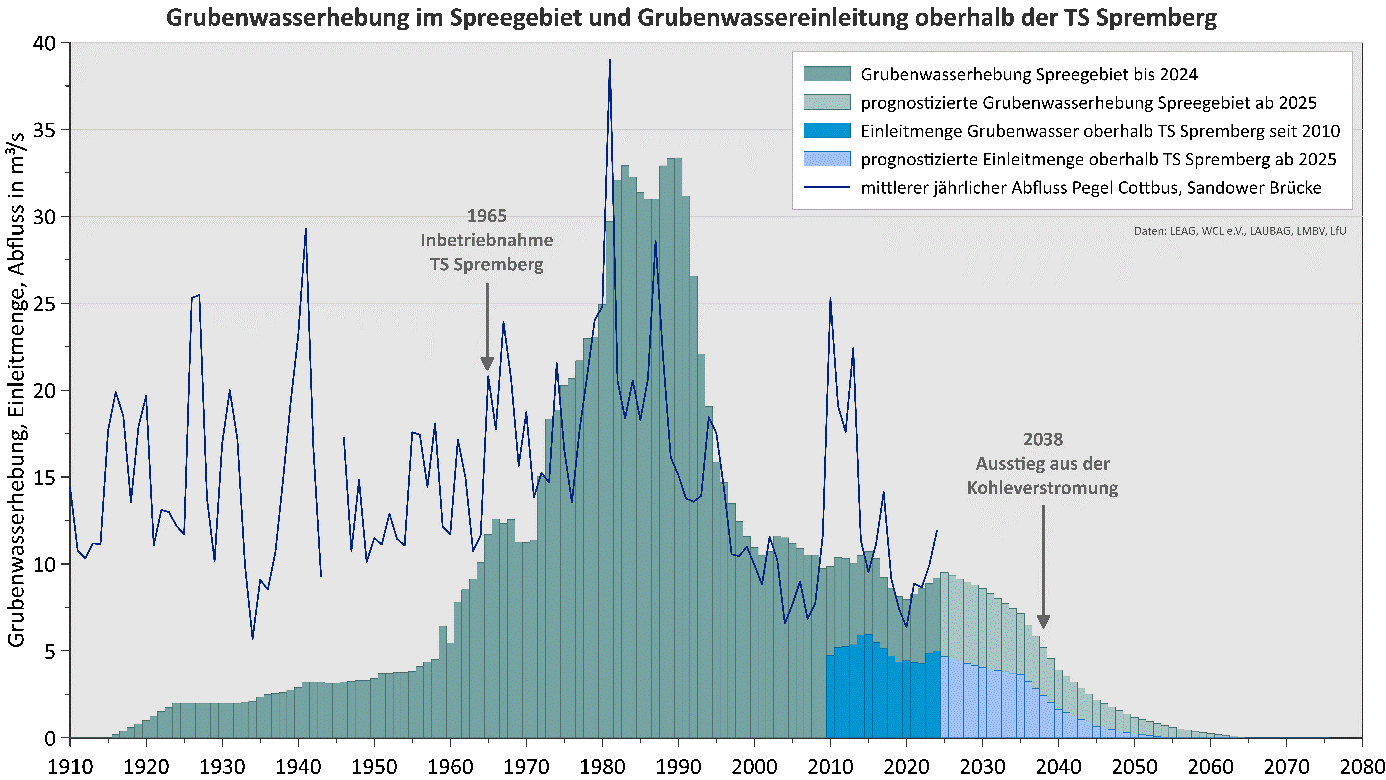
Der Klimawandel erhöht den Anspruch an die Speicherbewirtschaftung, da immer häufiger auf die Wasserreserven der Stauseen zurückgegriffen werden muss. Denn wegen der steigenden Temperaturen wird mehr verdunstet, aber die Niederschlagssummen stagnieren oder sinken. Für die Talsperre Spremberg bedeutet diese Entwicklung eine Verringerung des mittleren Zuflusses und gleichzeitig eine Erhöhung des Wasserbedarfs im Spreegebiet bis nach Berlin.
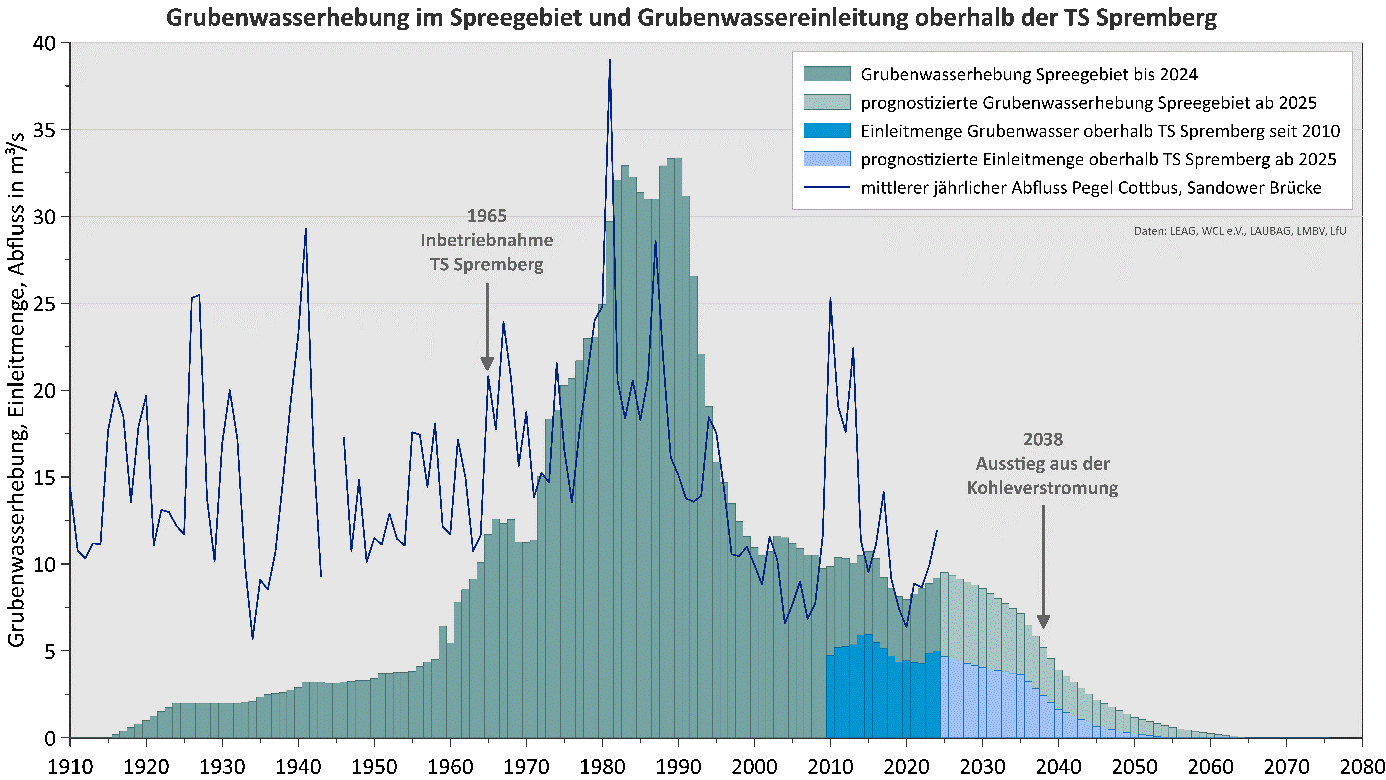
Der Klimawandel erhöht den Anspruch an die Speicherbewirtschaftung, da immer häufiger auf die Wasserreserven der Stauseen zurückgegriffen werden muss. Denn wegen der steigenden Temperaturen wird mehr verdunstet, aber die Niederschlagssummen stagnieren oder sinken. Für die Talsperre Spremberg bedeutet diese Entwicklung eine Verringerung des mittleren Zuflusses und gleichzeitig eine Erhöhung des Wasserbedarfs im Spreegebiet bis nach Berlin.
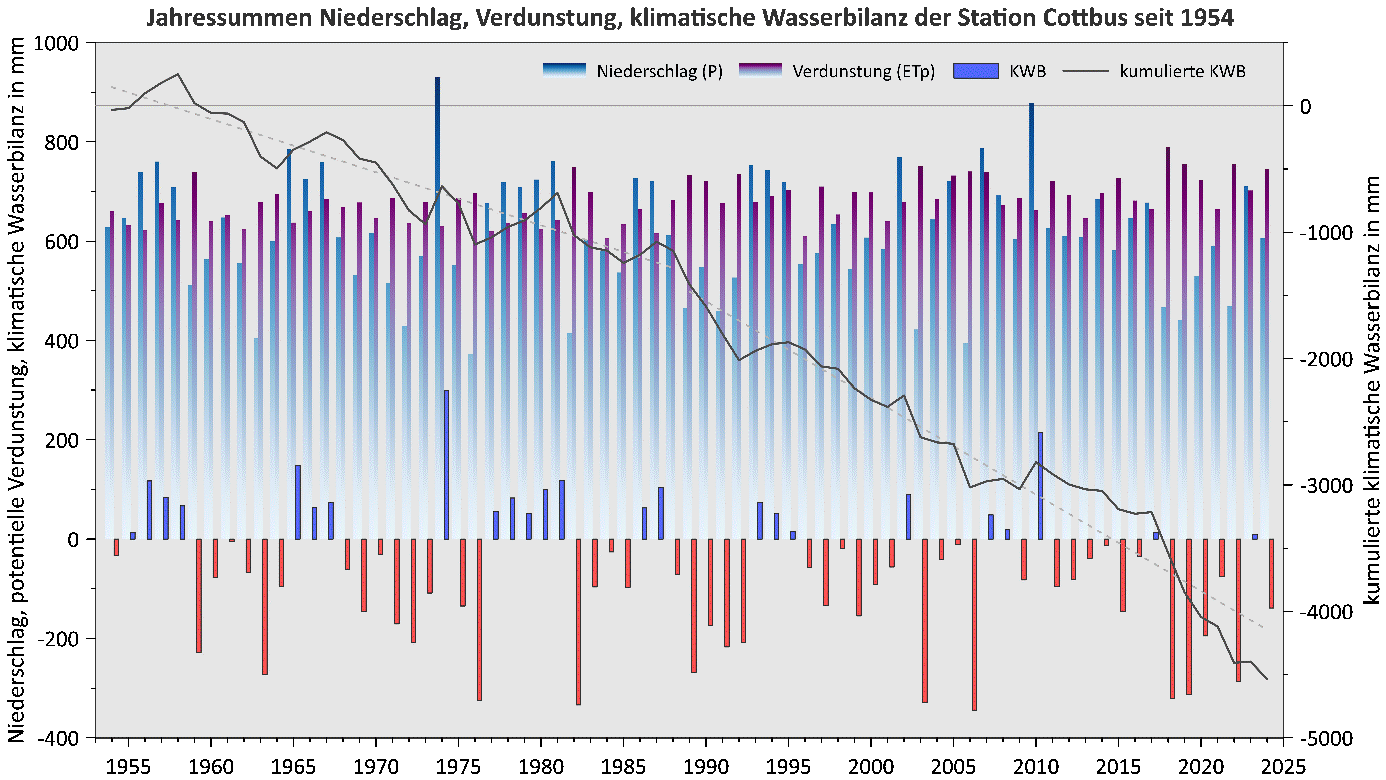
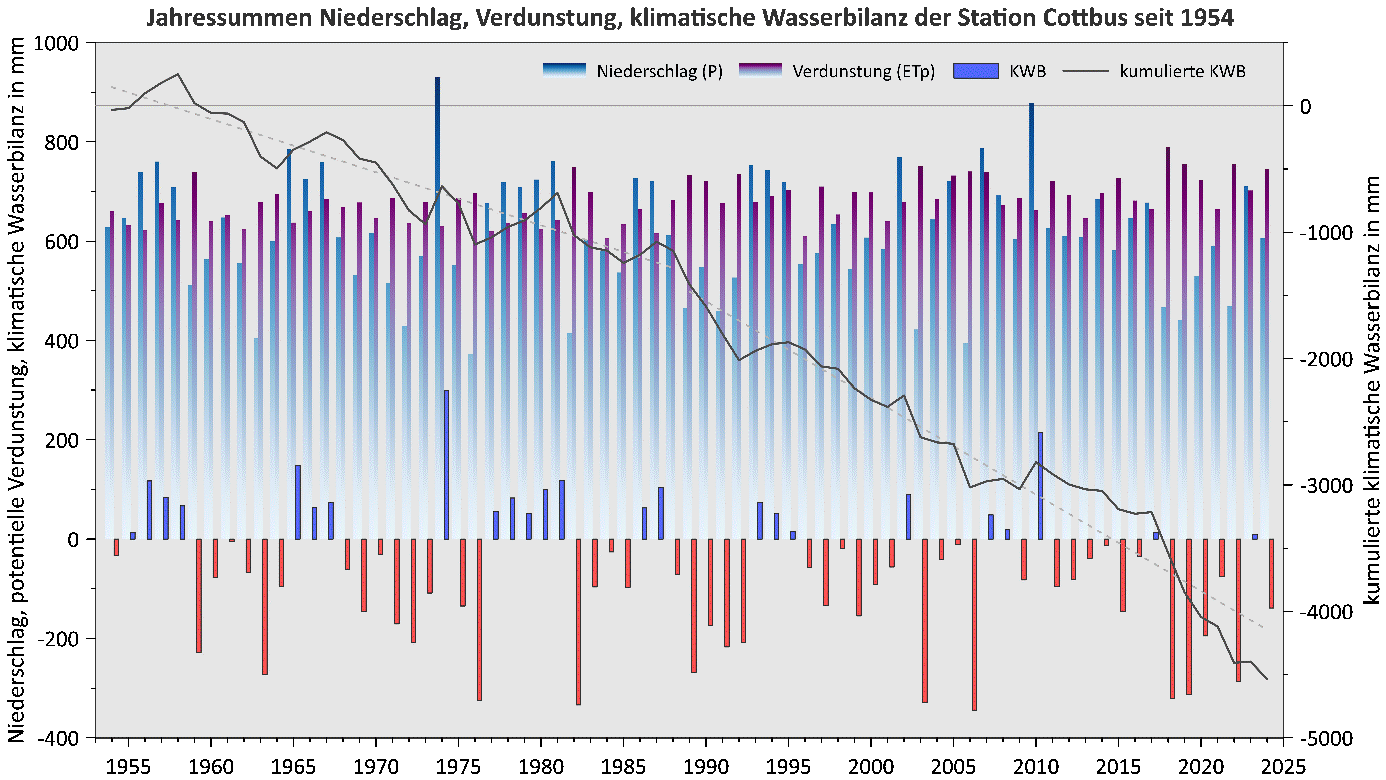
Bauwerksüberwachung und Unterhaltung
Für den sicheren Betrieb der Talsperre werden ständig umfangreiche Kontrollen und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt.
Das Messprogramm umfasst:
- Lagemessungen
Horizontale Lagemessungen, Fugenspalt- und Pfeilerneigungsmessungen
- Höhenmessungen
Geometrisches und hydrostatisches Nivellement
- Hydrometrische Messungen
Druckmessdosen im horizontalen Dichtungs-element, Sickerlinien und Grundwasser-standsmessungen, Sickerabflussmessung
- Meteorologische Messung
Für den sicheren Betrieb der Talsperre werden ständig umfangreiche Kontrollen und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt.
Das Messprogramm umfasst:
- Lagemessungen
Horizontale Lagemessungen, Fugenspalt- und Pfeilerneigungsmessungen
- Höhenmessungen
Geometrisches und hydrostatisches Nivellement
- Hydrometrische Messungen
Druckmessdosen im horizontalen Dichtungs-element, Sickerlinien und Grundwasser-standsmessungen, Sickerabflussmessung
- Meteorologische Messung
Ein Erd-Staudamm braucht intensive Pflege. Deshalb sorgt ein Team von Mitarbeitenden mit ständigen Funktionskontrollen und Unterhaltungsarbeiten dafür, dass die Anlage sicher und reibungslos funktioniert.
Ein Erd-Staudamm braucht intensive Pflege. Deshalb sorgt ein Team von Mitarbeitenden mit ständigen Funktionskontrollen und Unterhaltungsarbeiten dafür, dass die Anlage sicher und reibungslos funktioniert.


Reduzierung der Eisenbelastung in der Vorsperre Bühlow

Mit dem Wiederanstieg des Grundwassers in ehemaligen Braunkohlengebieten kommt es seit etwa 2010 zu einem massiven Eintrag von Eisenhydroxid in die Spree südlich Spremberg. Dieses sogenannte Eisenocker färbt das Wasser braun und setzt sich als Schlammfracht im Gewässer ab. Dadurch wird die Tier- und Pflanzenwelt stark beeinträchtigt. Zum Schutz der Spree und des UNESCO-Biosphärenreservates Spreewald führt die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) seit 2013 verschiedene Maßnahmen zur Wasserbehandlung durch, um die Ockerlast zu senken.
Neben der Errichtung und Betreibung von Wasserbehandlungsanlagen an der Spree und an der Kleinen Spree südlich Spremberg gehört dazu auch die Entschlammung der Vorsperre Bühlow. Diese dient der Ablagerung von Sedimenten, bevor die Spree in das Hauptbecken der Talsperre fließt.
Um die Effektivität der Vorsperre zu verbessern, hat die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) folgende Anlagen im Spreelauf vor dem Eingang in die Vorsperre installiert:
- Eine Bekalkungsanlage bei Spremberg-Wilhelmsthal, die das Ausfällen und Absetzen des Eisenockers durch Steigerung des pH-Wertes optimiert und
- eine Beflockungsanlage, die für das schnellere Absetzen des Eisenschlamms sorgt.
Durch diese Anlagen kann mehr Eisen in der Vorsperre zurückgehalten werden und es entstehen hier signifikant mehr Ablagerungen von Eisenhydroxidschlamm. Um deren Verlagerung in das Hauptbecken zu vermeiden, werden die ockerhaltigen Schlammablagerungen beräumt. Dafür werden die Schlämme mit einem Saug-/Spülbagger entnommen, in Sedimentationsbecken zwischengelagert und entwässert. Danach wird dieses Baggergut entsorgt. Bei der Beräumung der Vorsperre Bühlow wurden allein in den Jahren 2015 bis 2022 insgesamt cirka 360.000 Kubikmeter Eisenhydroxidschlamm entnommen.
Zur Umsetzung und Finanzierung dieser Maßnahmen haben das Landesamt für Umwelt und die LMBV vereinbart, dass die LMBV als Projektträgerin für die Beräumung der Vorsperre Bühlow von Eisenhydroxidschlamm zur Reduzierung der Eisenbelastung in der Spree tätig wird.
Weiterführende Informationen:

Mit dem Wiederanstieg des Grundwassers in ehemaligen Braunkohlengebieten kommt es seit etwa 2010 zu einem massiven Eintrag von Eisenhydroxid in die Spree südlich Spremberg. Dieses sogenannte Eisenocker färbt das Wasser braun und setzt sich als Schlammfracht im Gewässer ab. Dadurch wird die Tier- und Pflanzenwelt stark beeinträchtigt. Zum Schutz der Spree und des UNESCO-Biosphärenreservates Spreewald führt die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) seit 2013 verschiedene Maßnahmen zur Wasserbehandlung durch, um die Ockerlast zu senken.
Neben der Errichtung und Betreibung von Wasserbehandlungsanlagen an der Spree und an der Kleinen Spree südlich Spremberg gehört dazu auch die Entschlammung der Vorsperre Bühlow. Diese dient der Ablagerung von Sedimenten, bevor die Spree in das Hauptbecken der Talsperre fließt.
Um die Effektivität der Vorsperre zu verbessern, hat die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) folgende Anlagen im Spreelauf vor dem Eingang in die Vorsperre installiert:
- Eine Bekalkungsanlage bei Spremberg-Wilhelmsthal, die das Ausfällen und Absetzen des Eisenockers durch Steigerung des pH-Wertes optimiert und
- eine Beflockungsanlage, die für das schnellere Absetzen des Eisenschlamms sorgt.
Durch diese Anlagen kann mehr Eisen in der Vorsperre zurückgehalten werden und es entstehen hier signifikant mehr Ablagerungen von Eisenhydroxidschlamm. Um deren Verlagerung in das Hauptbecken zu vermeiden, werden die ockerhaltigen Schlammablagerungen beräumt. Dafür werden die Schlämme mit einem Saug-/Spülbagger entnommen, in Sedimentationsbecken zwischengelagert und entwässert. Danach wird dieses Baggergut entsorgt. Bei der Beräumung der Vorsperre Bühlow wurden allein in den Jahren 2015 bis 2022 insgesamt cirka 360.000 Kubikmeter Eisenhydroxidschlamm entnommen.
Zur Umsetzung und Finanzierung dieser Maßnahmen haben das Landesamt für Umwelt und die LMBV vereinbart, dass die LMBV als Projektträgerin für die Beräumung der Vorsperre Bühlow von Eisenhydroxidschlamm zur Reduzierung der Eisenbelastung in der Spree tätig wird.
Weiterführende Informationen:
Naturschutz und Naherholung
Seinerzeit entstand mit dem Bau der Talsperre die größte Wasserfläche in der Niederlausitz außerhalb der Teichlandschaften. Schon kurz nach dem Bau interessierten sich Ornithologen für den neu entstandenen Lebensraum. Ihr Fokus lag von Anfang an auf der Beobachtung von Wat- und Wasservögeln. Seit 1967 bis zum heutigen Tag finden hier Zählungen im Rahmen der Internationalen Wasservogelzählung statt, ein in seiner Vollständigkeit einzigartiger Datenbestand. 259 verschiedene Vogelarten wurden in dem Zeitraum von 1966 bis 2022 hier beobachtet. Für 110 Vogelarten wurden im Umfeld der Talsperre Brutnachweise erbracht.
Aufgrund ihres Vogelreichtums und die Vorkommen seltener Pflanzengesellschaften und vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten wurde die Talsperre Spremberg mit ihren Uferbereichen im Jahr 2004 als Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Seinerzeit entstand mit dem Bau der Talsperre die größte Wasserfläche in der Niederlausitz außerhalb der Teichlandschaften. Schon kurz nach dem Bau interessierten sich Ornithologen für den neu entstandenen Lebensraum. Ihr Fokus lag von Anfang an auf der Beobachtung von Wat- und Wasservögeln. Seit 1967 bis zum heutigen Tag finden hier Zählungen im Rahmen der Internationalen Wasservogelzählung statt, ein in seiner Vollständigkeit einzigartiger Datenbestand. 259 verschiedene Vogelarten wurden in dem Zeitraum von 1966 bis 2022 hier beobachtet. Für 110 Vogelarten wurden im Umfeld der Talsperre Brutnachweise erbracht.
Aufgrund ihres Vogelreichtums und die Vorkommen seltener Pflanzengesellschaften und vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten wurde die Talsperre Spremberg mit ihren Uferbereichen im Jahr 2004 als Naturschutzgebiet ausgewiesen.


Ein faszinierendes Bauwerk und hervorragende Naturbeobachtungsmöglichkeiten treffen hier zusammen. Das macht die Talsperre Spremberg zu allen Jahreszeiten zu einem beliebten und gut erschlossenen Erholungsgebiet in der Lausitz. Um den Speichersee verläuft ein etwa 20 km langer Rundweg, der zu Radtouren und Wanderungen einlädt. Im Sommer laden zwei offizielle Badestellen zum Schwimmen ein: am Ostufer in Bagenz und am Westufer in Klein Döbbern. Ob Baden, Angeln, Wassersport, Radfahren, Wandern oder Naturbeobachtung – die Talsperre Spremberg ist ein hervorragendes Ausflugsziel für Familien, Sportbegeisterte und Naturfreunde gleichermaßen.
Ein faszinierendes Bauwerk und hervorragende Naturbeobachtungsmöglichkeiten treffen hier zusammen. Das macht die Talsperre Spremberg zu allen Jahreszeiten zu einem beliebten und gut erschlossenen Erholungsgebiet in der Lausitz. Um den Speichersee verläuft ein etwa 20 km langer Rundweg, der zu Radtouren und Wanderungen einlädt. Im Sommer laden zwei offizielle Badestellen zum Schwimmen ein: am Ostufer in Bagenz und am Westufer in Klein Döbbern. Ob Baden, Angeln, Wassersport, Radfahren, Wandern oder Naturbeobachtung – die Talsperre Spremberg ist ein hervorragendes Ausflugsziel für Familien, Sportbegeisterte und Naturfreunde gleichermaßen.